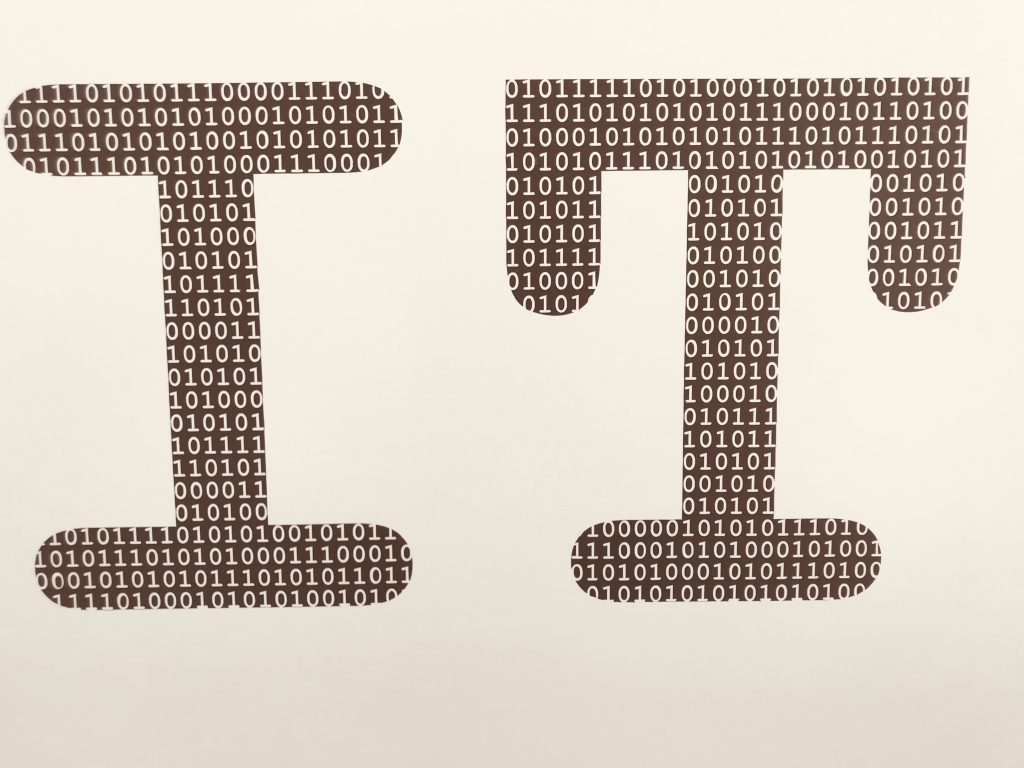News
Stand 06.12.2023: Bundesgerichtshof mit Paradigmenwechsel zum Schockschaden
Stand 16.08.2022: Bundesarbeitsgericht zu behördlich angeordneter Quarantäne während des Urlaubs
Pressemitteilung des BAG vom 16.08.2022
Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtet, um die Frage klären zu lassen, ob aus dem Unionsrecht die Verpflichtung des Arbeitgebers abzuleiten ist, einem Arbeitnehmer bezahlten Erholungsurlaub nachzugewähren, der zwar während des Urlaubs selbst nicht erkrankt ist, in dieser Zeit aber eine behördlich angeordnete häusliche Quarantäne einzuhalten hatte.
Der Kläger ist seit 1993 bei der Beklagten als Schlosser beschäftigt. Auf seinen Antrag bewilligte ihm die Beklagte acht Tage Erholungsurlaub für die Zeit vom 12. bis zum 21. Oktober 2020. Mit Bescheid vom 14. Oktober 2020 ordnete die Stadt Hagen die Absonderung des Klägers in häusliche Quarantäne für die Zeit vom 9. bis zum 21. Oktober 2020 an, weil er zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person Kontakt hatte. Für die Zeit der Quarantäne war es dem Kläger untersagt, seine Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamts zu verlassen und Besuch von haushaltsfremden Personen zu empfangen. Die Beklagte belastete das Urlaubskonto des Klägers mit acht Tagen und zahlte ihm das Urlaubsentgelt.
Der Kläger hat die auf Wiedergutschrift der Urlaubstage auf seinem Urlaubskonto gerichtete Klage darauf gestützt, es sei ihm nicht möglich gewesen, seinen Urlaub selbstbestimmt zu gestalten. Die Situation bei einer Quarantäneanordnung sei der infolge einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vergleichbar. Der Arbeitgeber müsse ihm deshalb entsprechend § 9 BUrlG, dem zufolge ärztlich attestierte Krankheitszeiten während des Urlaubs nicht auf den Jahresurlaub angerechnet werden dürfen, nachgewähren.
Das Landesarbeitsgericht ist dieser Auffassung gefolgt und hat der Klage stattgegeben. Für den Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts ist es entscheidungserheblich, ob es mit Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Euro-päischen Union im Einklang steht, wenn vom Arbeitnehmer beantragter und vom Arbeitgeber bewilligter Jahresurlaub, der sich mit einer nach Urlaubsbewilligung durch die zuständige Behörde angeordneten häuslichen Quarantäne zeitlich überschneidet, nach nationalem Recht nicht nachzugewähren ist, weil der betroffene Arbeitnehmer selbst nicht krank war.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 16. August 2022 – 9 AZR 76/22 (A) –
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 27. Januar 2022 – 5 Sa 1030/21 –
Stand 09.03.2022: BGH zur Berücksichtigungsfähigkeit von Zins- und Tilgungsleistungen für selbstgenutzte Immoblilien bei Kindesunterhalt
BGB § 1603
a) Auch beim Kindesunterhalt können grundsätzlich bis zur Höhe des Wohnvorteils neben den Zinszahlungen zusätzlich die Tilgungsleistungen berücksichtigt werden, die der Unterhaltspflichtige auf ein Darlehen zur Finanzierung einer selbstgenutzten Immobilie erbringt (Fortführung der Senatsbeschlüsse BGHZ 213, 288 = FamRZ 2017, 519 und vom 15. Dezember 2021 – XII ZB 557/20 – NZFam 2022, 208).
b) Überschreitet der Schuldendienst für die Immobilie den dadurch geschaffenen Wohnvorteil nicht, ist aber gleichwohl der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder gefährdet, kann dem gesteigert Unterhaltspflichtigen zwar nicht eine vollständige Aussetzung der Tilgung, wohl aber nach den Umständen des Einzelfalls ausnahmsweise eine Tilgungsstreckung zugemutet werden. Dies kommt beispielsweise dann in Betracht, wenn eine besonders hohe Tilgung vereinbart wurde oder die Immobilie bereits weitgehend abbezahlt ist.
BGH, Beschluss vom 9. März 2022 – XII ZB 233/21 – vorhergehend OLG Oldenburg und
AG Leer
Stand 02.03.2022: BGH zur Mietzahlungspflicht bei coronabedingter Absage einer Hochzeitsfeier
Pressemitteilung des BGH zum Urteil vom 2. März 2022 – XII ZR 36/21
Der u.a. für das gewerbliche Mietrecht zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte zu entscheiden, ob die Mieter der für eine Hochzeitsfeier gemieteten Räume zur vollständigen Zahlung der Miete verpflichtet sind, wenn die Feier aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte.
Die Kläger, die am 11. Dezember 2018 standesamtlich geheiratet hatten, mieteten bei der Beklagten Räume für eine am 1. Mai 2020 geplante Hochzeitsfeier mit ca. 70 Personen. Nach mündlichen Vertragsverhandlungen übersandte die Beklagte den Klägern eine auf den 5. April 2019 datierte Rechnung über die vereinbarte Miete von 2.600 €, die von den Klägern beglichen wurde. Die geplante Hochzeitsfeier konnte nicht durchgeführt werden, weil aufgrund der nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung in der ab dem 27. April 2020 gültigen Fassung Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen untersagt worden waren. Am 23. März 2020 bot die Beklagte den Klägern unter Angabe von Alternativterminen an, die Hochzeitsfeier zu verschieben. Mit Schreiben vom 24. April 2020 baten die Kläger um Rückzahlung der geleisteten Miete und erklärten gleichzeitig den Rücktritt vom Vertrag.
Das Amtsgericht hat die auf Rückzahlung der vollen Miete gerichtete Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläger hat das Landgericht das Urteil abgeändert und die Beklagte unter Abweisung der Klage im Übrigen verurteilt, an die Kläger 1.300 € nebst Zinsen zu zahlen. Auf die Revision der Beklagten hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die erstinstanzliche Entscheidung wiederhergestellt. Die Anschlussrevision der Kläger hat er zurückgewiesen.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie nicht zu einer Unmöglichkeit im Sinne der §§ 326 Abs. 1, 275 Abs. 1 BGB geführt haben. Denn der Beklagten war es trotz des zum Zeitpunkt der geplanten Hochzeitsfeier in Nordrhein-Westfalen geltenden Veranstaltungsverbots und der angeordneten Kontaktbeschränkungen nicht unmöglich, den Klägern den Gebrauch der Mietsache entsprechend dem vereinbarten Mietzweck zu gewähren. Ebenso zutreffend hat das Landgericht eine Minderung des Mietzinses nach § 536 Abs. 1 BGB abgelehnt. Durch die Coronaschutzverordnung wurde weder den Klägern die Nutzung der angemieteten Räume noch der Beklagten tatsächlich oder rechtlich die Überlassung der Mieträumlichkeiten verboten. Das Mietobjekt stand daher trotz der Regelungen in der Coronaschutzverordnung, die die Durchführung der geplanten Hochzeitsfeier untersagte, weiterhin für den vereinbarten Mietzweck zur Verfügung. Eine Geschäftsschließung, die auf einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie erfolgt, stellt somit keinen Mangel der Mietsache iSv § 536 Abs. 1 BGB dar. Beides hat der Senat in seiner grundlegenden Entscheidung vom 12. Januar 2022 (XII ZR 8/21) bereits ausgeführt. Gleiches gilt, wenn aus diesem Grund in Räumlichkeiten, die von Privatpersonen bei einem gewerblichen Anbieter angemietet wurden, eine dort geplante Veranstaltung nicht stattfinden konnte. Damit stand der Klägerin auch kein Recht zum Rücktritt nach § 326 Abs. 5 BGB oder zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrags nach § 543 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB zu.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts steht den Klägern im vorliegenden Einzelfall auch kein Anspruch aus § 313 Abs. 1 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) auf Anpassung des Mietvertrags dahingehend zu, dass sie von ihrer Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Miete vollständig oder teilweise befreit wären. Zwar kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Senatsurteil vom 12. Januar 2022 – XII ZR 8/21) für den Fall einer Geschäftsschließung, die auf einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie erfolgt, ein solcher Anpassungsanspruch grundsätzlich in Betracht. Nach der vorliegenden Entscheidung gilt dies auch für Räume, die zur Durchführung einer Veranstaltung gemietet wurden, wenn die Feier aufgrund von hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte.
Dies bedeutet aber nicht, dass der Mieter in diesen Fällen stets eine Anpassung der Miete verlangen kann. Ob ihm ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist, bedarf einer umfassenden Abwägung, bei der sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (§ 313 Abs. 1 BGB). Die Anwendung der Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage führt nur ausnahmsweise zur völligen Beseitigung des Vertragsverhältnisses; in aller Regel ist der Vertrag nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten und lediglich in einer den berechtigten Interessen beider Parteien Rechnung tragenden Form der veränderten Sachlage anzupassen. Nur wenn dies nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar ist, kann nach § 313 Abs. 3 BGB der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten oder bei Dauerschuldverhältnissen den Vertrag kündigen.
Im vorliegenden Fall beschränkt sich der Anpassungsanspruch der Kläger nach § 313 Abs. 1 BGB auf die von der Beklagten angebotene Verlegung der Hochzeitsfeier, weil bereits dadurch eine interessengerechte Verteilung des Pandemierisikos bei einem möglichst geringen Eingriff in die ursprüngliche Regelung hergestellt werden kann. Die Beklagte hat den Klägern bereits am 23. März 2020 eine Vielzahl von Ausweichterminen, auch für das Jahr 2021, angeboten. Den Klägern wäre zum Zeitpunkt der Berufungsentscheidung eine Verlegung der Hochzeitsfeier auch zumutbar gewesen. Sie hatten bereits im Dezember 2018 standesamtlich geheiratet und die Hochzeitsfeier stand daher nicht, wie regelmäßig, im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einer standesamtlichen oder kirchlichen Trauung. Die Kläger haben auch keine anderen Gründe dafür vorgetragen, dass die Feier ausschließlich am 1. Mai 2020 und nicht auch zu einem späteren Termin hätte stattfinden können. Sollten sie inzwischen endgültig auf eine Hochzeitsfeier verzichten wollen, fiele diese Entscheidung allein in ihren Risikobereich und hätte daher auf die vorzunehmende Vertragsanpassung keine Auswirkung. Denn sie beträfe das allgemeine Verwendungsrisiko eines Mieters und stünde nicht mehr in unmittelbarem Zusammenhang mit der pandemiebedingten Störung der Geschäftsgrundlage.
Stand 01.01.2022: Oberlandesgericht Düsseldorf veröffentlicht neue Leitlinien zum Unterhalt
08.11.2021: Dr. Scholten zum Geschäftsführer von Haus- und Grund gewählt
Die Mitglieder des Haus- und Grundbesitzerverein Kleve e.V. haben am Montag, den 08.11.2021 unseren Partner Dr. Karl Scholten zum neuen Geschäftsführer gewählt. Den Glückwünschen des ersten Vorsitzenden des Vereins, Herrn Steuerberater Fritz Kup, schließen wir uns an.
06.09.2021 – Update zum Behindertentestament
Schon seit längerem sind die Besonderheiten des sogenannten Behindertentestaments, also eines Testaments für Eltern behinderter Kinder, gewissermaßen ein besonderes Steckenpferd unseres Kollegen Dr. Holger Heinen, und findet dies seit heute auch Niederschlag auf unserer Website In der Rubrik Erbrecht mit der Unterseite „Das Behindertentestament“.
26. März 2021
Dr. Karl Scholten im Vorstand der Rechtsanwaltskammer
Verurteilung von Ärzten wegen Totschlags – Urteil im Berliner Zwillingsfall überwiegend bestätigt
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 002/2021 vom 04.01.2021
Beschluss vom 11. November 2020 – 5 StR 256/20
Das Landgericht Berlin hat die beiden Angeklagten, erfahrene Geburtsmediziner, wegen Totschlags (in minder schwerem Fall) zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und sechs Monaten bzw. einem Jahr und neun Monaten verurteilt und die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt.
Nach den Feststellungen des Landgerichts war eine Frau mit Zwillingen schwanger. Während der Schwangerschaft entwickelten sich Komplikationen. In deren Folge erlitt ein Zwilling schwere Hirnschäden, während sich der andere überwiegend normal entwickelte. Nach Beratung wurde die Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch bezüglich des geschädigten Zwillings nach § 218a Abs. 2 StGB gestellt. Ein solcher Abbruch kann bei entsprechender Indikation straffrei bis zur Geburt vorgenommen werden. Dieser spezielle Eingriff (selektiver Fetozid) ist aber mit Risiken für den anderen Zwilling verbunden. Er wurde zur Tatzeit 2010 nur von sehr wenigen spezialisierten Kliniken mittels einer besonderen Methode durchgeführt. Die Mutter wollte den Abbruch vornehmen lassen, fühlte sich in der von ihr aufgesuchten Spezialklinik aber nicht gut betreut. Sie wandte sich schließlich an die Angeklagte. Diese war als leitende Oberärztin in einer von dem Mitangeklagten geleiteten Klinik für Geburtsmedizin tätig. Das zu dieser Zeit gebräuchliche Verfahren zum selektiven Abbruch einer Zwillingsschwangerschaft wurde dort nicht angewendet. Stattdessen entwickelte die Angeklagte in Einvernehmen mit dem Mitangeklagten und der Mutter den Plan, mittels Kaiserschnitt zunächst das gesunde Kind zu entbinden und im unmittelbaren Anschluss daran den schwer geschädigten Zwilling zu töten. Nachdem sich bei der Mutter Wehen eingestellt hatten, gingen beide Angeklagte wie geplant vor und töteten nach Entbindung des gesunden Zwillings den lebensfähigen, aber schwer hirngeschädigten verbleibenden Zwilling durch Injektion einer Kaliumchlorid-Lösung. Dabei war ihnen bewusst, dass sie sich über geltendes Recht hinwegsetzen und einen Menschen töten würden. Erst mehrere Jahre später wurde die Staatsanwaltschaft durch eine anonyme Anzeige auf das Geschehen aufmerksam.
Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revisionen der Angeklagten überwiegend verworfen. Insbesondere hat er den Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Totschlags bestätigt. Die hierzu getroffenen Feststellungen beruhen auf einer rechtsfehlerfreien Beweiswürdigung. Auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellt die Tötung des lebensfähigen schwer geschädigten Zwillings ein strafbares Tötungsdelikt und nicht lediglich einen bei entsprechender Indikation straffreien Schwangerschaftsabbruch dar. Die Regeln über den Schwangerschaftsabbruch gelten nur bis zum Beginn der Geburt. Die Geburt beginnt bei einer Entbindung mittels Kaiserschnitt mit der Eröffnung der Gebärmutter, wenn das Kind damit vom Mutterleib getrennt werden soll. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Kind oder mehrere Kinder betroffen sind. Allerdings hat der Bundesgerichtshof die vom Landgericht verhängten Strafen aufgehoben, weil den Angeklagten zur Last gelegt wurde, dass sie die Tat geplant und nicht in einer Notfallsituation begangen haben. Dieser Gesichtspunkt ist bei einer medizinischen Operation kein zulässiger Erschwerungsgrund. Während der Schuldspruch wegen Totschlags rechtskräftig ist, muss über die Höhe der Strafen deshalb noch einmal neu verhandelt werden.
Dürfen heimlich angefertigte Audioaufnahmen als Beweismittel verwendet werden? Das Oberlandesgericht Brandenburg entscheidet in einem aktuellen Beschluss vom 05.08.2020
Durch Beschluss vom 05.08.2020 (15 UF 126/20, vergleiche FamRZ 2020 Seite 1834) hat das Oberlandesgericht Brandenburg entschieden, dass in Ausnahmefällen ohne Einwilligung des Gegners aufgezeichnete Privatgespräche verwertet werden dürfen, wenn der Schutz der betroffenen Rechtsgüter im konkreten Fall Vorrang vor dem Schutz des gesprochenen Wortes haben muss.
In dem vom Oberlandesgericht zu beurteilenden Fall hatte der Antragsgegner nach dem Vorbringen der Antragstellerin diese in einer Auseinandersetzung am 19.05.2020 mit dem Tode bedroht und die Antragstellerin über diesen Vorfall dem Gericht eine Audioaufnahme vorgespielt.
Das Oberlandesgericht Brandenburg hat die Verwertung dieser Audiodatei ausnahmsweise zugelassen und ausgeführt, dass in der Regel zwar Privatgespräche ohne Einwilligung des Gesprächspartners weder auf einen Datenträger aufgezeichnet noch durch Abspielen der Aufzeichnung anderen zugänglich gemacht werden dürfen und die Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot nicht nur eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen, sondern auch eine Straftat (§ 201 StGB) darstellt. Im Regelfall können solche Aufnahmen daher in zivilgerichtlichen Verfahren nicht verwendet worden.
Das Oberlandesgericht hält den Schutz des gesprochenen Wortes jedoch nicht für schrankenlos und insbesondere wenn es den Konklikt zu dem ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrecht eines anderen auflöst, zu dessen Durchsetzung die Aufnahme verhelfen soll, kann das Selbstbestimmungsrecht über das eigene Wort sich nicht über dessen schutzwürdige Belange schlechthin hinwegsetzen. Das Gericht gehtt daher davon aus, dass kein absolutes Verwertungsverbot nicht gestatteter Tonaufnahmen besteht.
Bundesgerichtshof zu Ansprüchen des Mieters auf Schadensersatz nach einem Auszug aus der Mietwohnung aufgrund pflichtwidrigen Verhaltens des Vermieters
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 158/2020 vom 09.12.2020
Urteile vom 9. Dezember 2020 – VIII ZR 238/18 und VIII ZR 371/18
Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute in zwei Verfahren entschieden, dass ein Mieter, der infolge einer Pflichtverletzung des Vermieters aus der Wohnung auszieht und keine neue Wohnung anmietet, sondern Wohnungs- oder Hauseigentum erwirbt, die zum Zwecke des Eigentumserwerbs angefallenen Maklerkosten nicht als Schadensersatz vom Vermieter ersetzt verlangen kann.
Sachverhalt und Prozessverlauf:
Verfahren VIII ZR 238/18:
Der Kläger war Mieter einer Wohnung der Beklagten in Berlin. Ihm wurde zum 31. August 2012 wegen Eigenbedarfs gekündigt. Das Amtsgericht gab der nachfolgenden Räumungsklage statt. Während des laufenden Berufungsverfahrens erwarb der Kläger unter Einschaltung eines Maklers eine Eigentumswohnung in Berlin. Hierfür stellte ihm der Makler eine Provision in Höhe von 29.543,42 € in Rechnung. In der Berufungsinstanz schlossen die Parteien einen Räumungsvergleich, worin sich der Kläger zum Auszug bis Ende Februar 2016 verpflichtete.
Die Beklagte realisierte den in der Kündigung behaupteten Eigenbedarf nach Auszug des Klägers nicht. Mit der Behauptung, der Eigenbedarf sei nur vorgetäuscht gewesen, nimmt der Kläger die Beklagte auf Zahlung von Schadensersatz in Anspruch. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien aufgrund der vom Senat zugelassenen Revision darüber, ob dem Kläger die für den Erwerb der Eigentumswohnung aufgewendeten Maklerkosten in Höhe von 29.543,42 € zustehen.
Zur Begründung hat das einen solchen Anspruch (anders als das Amtsgericht) bejahende Landgericht ausgeführt, der Kläger könne von der Beklagten wegen Verletzung der nachvertraglichen Treuepflicht (§ 280 Abs. 1 BGB) auch die für den Ersatzwohnungskauf angefallenen Maklerkosten verlangen. Denn die Beklagte sei nicht nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, sondern darüber hinaus bis zum Ablauf der im Vergleich vereinbarten Räumungsfrist verpflichtet gewesen, den Kläger über den nachträglichen Wegfall des Eigenbedarfs zu informieren.
Zu dem hiernach erstattungsfähigen Schaden zählten auch die für die Vermittlung der Eigentumswohnung angefallenen Maklerkosten. Es könne keinen Unterschied machen, ob sich der Kläger dafür entscheide – wie hier – Eigentum zu erwerben oder (nochmals) eine Wohnung anzumieten.
Verfahren VIII ZR 371/18:
In diesem Verfahren begehrt der Mieter ebenfalls den Ersatz von Kündigungsfolgeschäden. Nachdem das Mietverhältnis der Parteien durch diverse Streitigkeiten bereits belastet war, kündigte der beklagte Mieter Anfang August 2013 das Mietverhältnis fristlos, unter anderem deshalb, weil der Vermieter beziehungsweise ein von diesem beauftragter Handwerker den Balkon der Mietwohnung ohne Einverständnis betreten habe. Unter Einschaltung eines Maklers erwarb der Beklagte am 24. August 2013 in der Nähe seiner von der bisherigen Mietwohnung 250 km entfernten Arbeitsstelle ein Einfamilienhaus, das im Dezember 2013 bezugsfertig wurde. Am 30. September 2013 räumte der Beklagte die Mietwohnung und bezog eine Zwischenunterkunft.
Mit seiner Widerklage nimmt der Beklagte den Kläger auf Schadensersatz in Anspruch. Er macht unter anderem die Maklerkosten für den Hauserwerb (13.030,50 €), die Umzugskosten, die Kosten der Übergangsunterkunft sowie die Kosten für den Umbau und Wiedereinbau seiner Einbauküche geltend. Die Widerklage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, zwar komme grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch des Beklagten aus § 280 Abs. 1 BGB in Betracht, weil der Mieter aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens des Vermieters zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt gewesen sei.
Zwar könnten Zweifel daran bestehen, ob die Kündigung überhaupt kausal auf die Pflichtverletzung zurückzuführen sie. Dies könne jedoch dahinstehen, weil die geltend gemachten Schäden jedenfalls nicht ersatzfähig seien. Es seien nur solche Schäden zurechenbar, die bei Anmietung einer Ersatzwohnung in der Nähe der bisherigen angefallen wären. Vorliegend habe der Beklagten jedoch Eigentum erworben und dies unter Verlagerung seines Lebensmittelpunktes. Es handele sich daher weder um vergleichbaren noch um angemessenen Ersatzwohnraum. Vielmehr habe der Beklagte anlässlich der Kündigung seine Lebensumstände so verändert, dass die in der Folge getätigten Aufwendungen nicht mehr zurechenbar auf die Pflichtverletzung des Klägers zurückzuführen seien.
Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs:
Der Bundesgerichtshof hat in beiden Fällen entschieden, dass die Maklerkosten, welche die jeweiligen Mieter zwecks Erwerbs einer Eigentumswohnung beziehungsweise eines Hauses zu Eigentum aufgewandt haben, keinen erstattungsfähigen Schaden darstellen.
Im Verfahren VIII ZR 371/18 hat das Berufungsgericht eine den Mieter zur fristlosen Kündigung berechtigende Pflichtverletzung rechtsfehlerfrei bejaht.
Im Verfahren VIII ZR 238/18 hingegen ist bereits eine Pflichtverletzung der Vermieterin nicht rechtsfehlerfrei festgestellt. Zwar handelt ein Vermieter pflichtwidrig und ist dem Mieter zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er eine Kündigung des Mietvertrags schuldhaft auf einen in Wahrheit nicht bestehenden Eigenbedarf (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) stützt oder er den Mieter nicht über einen späteren Wegfall des geltend gemachten Eigenbedarfs informiert. Diese Hinweispflicht besteht jedoch nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist und nicht – wie vom Berufungsgericht angenommen – bis zum Ablauf der im Vergleich vereinbarten Räumungsfrist.
Ob hiernach der Vermieterin eine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist, konnte im Ergebnis offenbleiben. Denn die Schadensersatzpflicht des pflichtwidrig handelnden Vermieters umfasst nicht die Maklerkosten, die einem Mieter entstehen, der von der Anmietung einer neuen Wohnung absieht und stattdessen Wohnungs- oder Hauseigentum erwirbt.
Zwar stellt der Erwerb von Eigentum an einer Wohnung beziehungsweise einem Hausanwesen vorliegend noch eine adäquat kausale Reaktion des Mieters auf eine (unterstellte) Pflichtverletzung des Vermieters dar. Denn es lag nicht außerhalb des zu erwartenden Verlaufs der Dinge, dass die Mieter den notwendigen Wohnungswechsel zum Anlass nahmen, ihre Wohnbedürfnisse künftig nicht in angemieteten, sondern eigenen Räumlichkeiten zu befriedigen und zu dessen Erwerb einen Makler einschalten.
Jedoch sind die im Zuge des Eigentumserwerbs aufgewandten Maklerkosten nicht mehr vom Schutzzweck der jeweils verletzten Vertragspflicht umfasst. Denn eine vertragliche Haftung – hier der jeweiligen Vermieter – besteht nur für diejenigen äquivalenten und adäquaten Schadensfolgen, zu deren Abwendung die verletzte Vertragspflicht übernommen wurde. Der Schaden muss in einem inneren Zusammenhang mit dem (verletzten) Gebrauchserhaltungsinteresse des Mieters stehen, was bezüglich der Maklerkosten nicht der Fall ist.
Denn die Mieter haben mithilfe des Maklers nicht lediglich ihren Besitzverlust (an der bisherigen Wohnung) ausgeglichen, sondern im Vergleich zu ihrer bisherigen Stellung eine hiervon zu unterscheidende (Rechts-)Stellung als Eigentümer eingenommen. Der (bisherige) Mieter unterliegt als (späterer) Eigentümer hinsichtlich der Wohnungsnutzung keinen vertraglichen Bindungen mehr. Sein Besitzrecht an der Wohnung ist nicht mehr wie zuvor ein abgeleitetes, sondern ein ihm originär zustehendes Recht, das ihm grundsätzlich eine uneingeschränkte und eigenverantwortliche Nutzungs- und Verfügungsbefugnis (§ 903 BGB) gibt.
Zudem ist dieses (Nutzungs-)Recht nicht zeitlich begrenzt. Demgegenüber gehört es zum Wesen des Mietvertrags, dass dem Mieter (lediglich) ein Anspruch auf Gebrauchsüberlassung auf Zeit zusteht. Diese zeitliche Begrenzung ist auch zu berücksichtigen, wenn es um die Bestimmung der Ersatzfähigkeit von Schäden des Mieters in Fällen wie den vorliegenden geht. Durch den Abschluss des Mietvertrags hatte der Mieter sein Interesse an der Erlangung eines zeitlich begrenzten Gebrauchsrechts gezeigt. Erwirbt er eine Wohnung beziehungsweise ein Hausanwesen zu Eigentum verfolgt er bezüglich der Deckung seines Wohnbedarfs andere Interessen als bisher.
Im Verfahren VIII ZR 371/18 hat der Bundesgerichtshof das Verfahren an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit geprüft werden kann, ob dem Mieter ein Anspruch auf Ersatz der weiter geltend gemachten Kündigungsfolgeschäden in Form der Umzugskosten, der Mehrkosten für die Übergangsunterkunft sowie der Kosten für den Aus- und Umbau der Einbauküche zusteht.
Im Gegensatz zu den Maklerkosten für den Eigentumserwerb stehen diese Schäden noch in dem gebotenen inneren Zusammenhang zur Vertragspflichtverletzung des Vermieters. Der Umstand, dass der Mieter sich entschließt, seinen künftigen Wohnbedarf nicht mehr mittels der Anmietung von Räumlichkeiten zu decken, sondern Eigentum zu erwerben, hat bezüglich dieser Schadenspositionen, die anders als die Maklerkosten, bereits in dem durch die Pflichtverletzung des Vermieters herbeigeführten Wohnungsverlust angelegt sind, keinen Einfluss auf die grundsätzliche Erstattungsfähigkeit. Sofern daher die Pflichtverletzung für die Kündigung kausal geworden ist (was das Berufungsgericht bisher offengelassen hat), kann die grundsätzliche Ersatzfähigkeit der Kosten für den Umzug und eine Übergangsunterkunft nicht verneint werden.
Im Verfahren 238/18 hat der Senat das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Entscheidung des Amtsgerichts wiederhergestellt, das die Klage wegen der für den Kauf einer Eigentumswohnung aufgewendeten Maklerkosten abgewiesen hatte.
Bundesgerichtshof bestätigt Freisprüche in zwei Fällen ärztlich assistierter Selbsttötungen
Mitteilung der Pressestelle des BGH Nr. 090/2019 vom 03.07.2019
Urteile vom 3. Juli 2019 – 5 StR 132/18 und 5 StR 393/18
Das Landgericht Hamburg und das Landgericht Berlin haben jeweils einen angeklagten Arzt von dem Vorwurf freigesprochen, sich in den Jahren 2012 bzw. 2013 durch die Unterstützung von Selbsttötungen sowie das Unterlassen von Maßnahmen zur Rettung der bewusstlosen Suizidentinnen wegen Tötungsdelikten und unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht zu haben.
Hamburger Verfahren
Nach den Feststellungen im Urteil des Landgerichts Hamburg litten die beiden miteinander befreundeten, 85 und 81 Jahre alten suizidwilligen Frauen an mehreren nicht lebensbedrohlichen, aber ihre Lebensqualität und persönlichen Handlungsmöglichkeiten zunehmend einschränkenden Krankheiten. Sie wandten sich an einen Sterbehilfeverein, der seine Unterstützung bei ihrer Selbsttötung von der Erstattung eines neurologisch-psychiatrischen Gutachtens zu ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit abhängig machte. Dieses erstellte der Angeklagte, ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Er hatte an der Festigkeit und Wohlerwogenheit der Suizidwünsche keine Zweifel. Auf Verlangen der beiden Frauen wohnte der Angeklagte der Einnahme der tödlich wirkenden Medikamente bei und unterließ es auf ihren ausdrücklichen Wunsch, nach Eintritt ihrer Bewusstlosigkeit Rettungsmaßnahmen einzuleiten.
Das Landgericht Hamburg hat den Angeklagten aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen freigesprochen. Beide Frauen hätten die alleinige Tatherrschaft über die Herbeiführung ihres Todes gehabt. Der Angeklagte sei aufgrund der ihm bekannten Freiverantwortlichkeit der Suizide auch nicht zu ihrer Rettung verpflichtet gewesen. Anhaltspunkte für eine nach Einnahme der Medikamente eingetretene Änderung des Willens der beiden Frauen konnte das Landgericht nicht feststellen.
Berliner Verfahren
Gemäß den Feststellungen im Urteil des Landgerichts Berlin hatte der Angeklagte als Hausarzt einer Patientin Zugang zu einem in hoher Dosierung tödlich wirkenden Medikament verschafft. Die 44-jährige Frau litt seit ihrer Jugend an einer nicht lebensbedrohlichen, aber starke krampfartige Schmerzen verursachenden Erkrankung und hatte den Angeklagten – nachdem sie bereits mehrere Selbsttötungsversuche unternommen hatte – um Hilfe beim Sterben gebeten. Der Angeklagte betreute die nach Einnahme des Medikaments Bewusstlose – wie von ihr zuvor gewünscht – während ihres zweieinhalb Tage dauernden Sterbens. Hilfe zur Rettung ihres Lebens leistete er nicht.
Das Landgericht Berlin hat den Angeklagten aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Die Bereitstellung der Medikamente stelle sich als straflose Beihilfe zur eigenverantwortlichen Selbsttötung dar. Zu Rettungsbemühungen nach Eintritt der Bewusstlosigkeit sei er nicht verpflichtet gewesen. Denn die freiverantwortliche Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Verstorbenen habe eine Pflicht des Angeklagten zur Abwendung ihres Todes entfallen lassen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Der 5. („Leipziger“) Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revisionen der Staatsanwaltschaft verworfen und damit die beiden freisprechenden Urteile bestätigt.
Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten für ihre im Vorfeld geleisteten Beiträge zu den Suiziden hätte vorausgesetzt, dass die Frauen nicht in der Lage waren, einen freiverantwortlichen Selbsttötungswillen zu bilden. In beiden Fällen haben die Landgerichte rechtsfehlerfrei keine die Eigenveranwortlichkeit der Suizidentinnen einschränkenden Umstände festgestellt. Deren Sterbewünsche beruhten vielmehr auf einer im Laufe der Zeit entwickelten, bilanzierenden „Lebensmüdigkeit“ und waren nicht Ergebnis psychischer Störungen.
Beide Angeklagte waren nach Eintritt der Bewusstlosigkeit der Suizidentinnen auch nicht zur Rettung ihrer Leben verpflichtet. Der Angeklagte des Hamburger Verfahrens hatte schon nicht die ärztliche Behandlung der beiden sterbewilligen Frauen übernommen, was ihn zu lebensrettenden Maßnahmen hätte verpflichten können. Auch die Erstellung des seitens des Sterbehilfevereins für die Erbringung der Suizidhilfe geforderten Gutachtens sowie die vereinbarte Sterbebegleitung begründeten keine Schutzpflicht für deren Leben. Der Angeklagte im Berliner Verfahren war jedenfalls durch die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der später Verstorbenen von der aufgrund seiner Stellung als behandelnder Hausarzt grundsätzlich bestehenden Pflicht zur Rettung des Lebens seiner Patientin entbunden.
Eine in Unglücksfällen jedermann obliegende Hilfspflicht nach § 323c StGB wurde nicht in strafbarer Weise verletzt. Da die Suizide, wie die Angeklagten wussten, sich jeweils als Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der sterbewilligen Frauen darstellten, waren Rettungsmaßnahmen entgegen deren Willen nicht geboten.
Am Straftatbestand der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) war das Verhalten der Angeklagten wegen des strafrechtlichen Rückwirkungsverbotes nicht zu messen, da dieser zur Zeit der Suizide noch nicht in Kraft war.
Dass die Angeklagten mit der jeweiligen Leistung von Hilfe zur Selbsttötung möglicherweise ärztliche Berufspflichten verletzt haben, ist für die Strafbarkeit ihres Verhaltens im Ergebnis nicht von Relevanz.
Die Urteile des Landgerichts Hamburg und des Landgerichts Berlin sind damit rechtskräftig.
Urteil vom 3. Juli 2019 – 5 StR 132/18
Bundesgerichtshof zum Wegfall der Geschäftsgrundlage einer Schenkung bei Scheitern einer Lebensgemeinschaft
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 082/2019 vom 18.06.2019
Urteil vom 18. Juni 2019 – X ZR 107/16
Sachverhalt:
Die Klägerin und ihr Ehemann sind die Eltern der ehemaligen Lebensgefährtin des Beklagten; die nichteheliche Lebensgemeinschaft der Tochter mit dem Beklagten bestand seit 2002. Im Jahr 2011 kauften die Tochter der Klägerin und der Beklagte eine Immobilie zum gemeinsamen Wohnen. Die Klägerin und ihr Ehemann wandten ihnen zur Finanzierung Beträge von insgesamt 104.109,10 € zu. Ende Februar 2013 trennten sich die Tochter der Klägerin und der Beklagte. Die Klägerin verlangt vom Beklagten die Hälfte der zugewandten Beträge zurück. Sie hat dieses Begehren in erster Linie auf eine Darlehensabrede gestützt; hilfsweise hat sie sich den Vortrag des Beklagten zu eigen gemacht, die Zuwendungen seien unentgeltlich erfolgt.
Bisheriger Prozessverlauf:
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; die Berufung des Beklagten ist im Wesentlichen erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage des Vortrags des Beklagten einen Anspruch der Klägerin wegen eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage für begründet gehalten. Mit der Auflösung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft hätten sich Umstände schwerwiegend verändert, von denen die Vertragsparteien der Schenkung gemeinsam ausgegangen seien. Den Zuwendungen habe die Vorstellung zugrunde gelegen, die Beziehung zwischen der Tochter der Klägerin und dem Beklagten werde lebenslangen Bestand haben. Mit der Trennung, die kurze Zeit nach der Schenkung erfolgt sei, sei diese Geschäftsgrundlage weggefallen, und der Klägerin sei ein Festhalten an der Schenkung nicht zuzumuten. Da die Tochter der Klägerin jedoch mindestens vier Jahre in der gemeinsamen Wohnimmobilie gewohnt habe, habe sich der mit der Schenkung verfolgte Zweck teilweise verwirklicht. Diese Zweckerreichung sei in Relation zur erwarteten Gesamtdauer der Lebensgemeinschaft zu setzen. Demnach habe der Beklagte 91,6 % seines hälftigen Anteils an den Zuwendungen, d.h. 47.040,77 €, zurückzuzahlen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der für das Schenkungsrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Beurteilung des Berufungsgerichts im Ergebnis gebilligt und deshalb die Revision des Beklagten zurückgewiesen.
Wie bei jedem Vertrag können auch dem Schenkungsvertrag Vorstellungen eines oder beider Vertragspartner vom Bestand oder künftigen Eintritt bestimmter Umstände zugrunde liegen, die nicht Vertragsinhalt sind, auf denen der Geschäftswille jedoch gleichwohl aufbaut. Deren schwerwiegende Veränderung kann daher wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage eine Anpassung des Vertrages oder gar das Recht eines oder beider Vertragspartner erfordern, sich vom Vertrag zu lösen (§ 313 Abs. 1 BGB).
Bei der Prüfung, was im Einzelfall Geschäftsgrundlage eines Schenkungsvertrags ist, ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Schenkungsvertrag keinen Vertrag darstellt, bei dem Leistung und Gegenleistung ausgetauscht werden. Der Schenkungsvertrag ist vielmehr durch das Versprechen einer einseitigen unentgeltlichen Zuwendung gekennzeichnet, mit der der Schenker einen Vermögensgegenstand weggibt und dem Beschenkten – soweit die Schenkung nicht unter einem Vorbehalt oder einer Bedingung oder mit einer Auflage erfolgt – diesen Gegenstand zur freien Verfügung überlässt. Der Beschenkte schuldet keine Gegenleistung; er „schuldet“ dem Schenker nur Dank für die Zuwendung, und der Schenker kann das Geschenk zurückfordern, wenn der Beschenkte diese Dankbarkeit in besonderem Maße vermissen lässt und sich durch eine schwere Verfehlung gegenüber dem Schenker als grob undankbar erweist (§ 530 Abs. 1 BGB).
Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen Erwerb bestimmter Geldbeträge an das eigene Kind und dessen Partner hegt der Schenker typischerweise die Erwartung, die Immobilie werde von den Beschenkten zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt. Dies erlaubt jedoch noch nicht die Annahme, Geschäftsgrundlage der Schenkung sei die Vorstellung, die gemeinsame Nutzung der Immobilie werde erst mit dem Tod eines Partners enden. Denn mit einem Scheitern der Beziehung muss der Schenker rechnen, und die Folgen für die Nutzung des Geschenks gehören zu dem vertraglich übernommenen Risiko einer freigiebigen Zuwendung, deren Behaltendürfen der Beschenkte nicht rechtfertigen muss.
Im Streitfall beruht die Feststellung des Berufungsgerichts, die Zuwendung sei in der Erwartung erfolgt, die Beziehung zwischen der Tochter der Klägerin und dem Beklagten werde andauern und das zu erwerbende Grundeigentum werde die „räumliche Grundlage“ des weiteren, nicht nur kurzfristigen Zusammenlebens der Partner bilden, auf einer rechtlich möglichen Würdigung des Sachvortrags der Parteien. Diese Geschäftsgrundlage der Schenkung ist weggefallen, nicht weil die Beziehung kein Leben lang gehalten hat, sondern weil sich die Tochter der Klägerin und der Beklagte schon weniger als zwei Jahre nach der Schenkung getrennt haben und sich die für die Grundstücksschenkung konstitutive Annahme damit als unzutreffend erwiesen hat, die Partner würden die Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fortsetzen.
In einem solchen Fall ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht erfolgt wäre, wäre für die Schenker das alsbaldige Ende dieses Zusammenlebens erkennbar gewesen. Dann kann dem Schenker regelmäßig nicht zugemutet werden, sich an der Zuwendung festhalten lassen zu müssen, und ist dem Beschenkten, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, seinerseits zuzumuten, das Geschenk zurückzugeben. Da es regelmäßig fernliegt, dass der Schenker die Höhe des Geschenks um eine bestimmte Quote vermindert hätte, wenn er die tatsächliche Dauer der Lebensgemeinschaft vorausgesehen hätte, kommt die „Berechnung“ eines an einer solchen Quote orientierten Rückzahlungsanspruchs, wie sie das Berufungsgericht vorgenommen hat, grundsätzlich nicht in Betracht. Im Streitfall wirkt sich dies allerdings nicht aus, da nur der Beklagte ein Rechtsmittel gegen das Berufungsurteil eingelegt hat.
Vorinstanzen:
LG Potsdam – Urteil vom 20. August 2015 – 2 O 166/14
OLG Brandenburg – Urteil vom 26. Oktober 2016 – 4 U 159/15
Dr. Karl Scholten gibt Auskunft bei Brisant.
Für das ARD-Magazin vom 3. Mai bewertet unser Fachanwalt für Strafrecht einen Vorfall schlimmer Tierquälerei in Geldern.
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 040/2019 vom 02.04.2019
Bundesgerichtshof entscheidet über Haftung wegen Lebenserhaltung durch künstliche Ernährung
Urteil vom 2. April 2019 – VI ZR 13/18
Sachverhalt:
Der 1929 geborene Vater des Klägers (Patient) litt an fortgeschrittener Demenz. Er war bewegungs- und kommunikationsunfähig. In den letzten beiden Jahren seines Lebens kamen Lungenentzündungen und eine Gallenblasenentzündung hinzu. Im Oktober 2011 verstarb er. Der Patient wurde von September 2006 bis zu seinem Tod mittels einer PEG-Magensonde künstlich ernährt. Er stand unter Betreuung eines Rechtsanwalts. Der Beklagte, ein niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin, betreute den Patienten hausärztlich. Der Patient hatte keine Patientenverfügung errichtet. Sein Wille hinsichtlich des Einsatzes lebenserhaltender Maßnahmen ließ sich auch nicht anderweitig feststellen. Es war damit nicht über die Fallgestaltung zu entscheiden, dass die künstliche Ernährung gegen den Willen des Betroffenen erfolgte.
Der Kläger macht geltend, die künstliche Ernährung habe spätestens seit Anfang 2010 nur noch zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens des Patienten geführt. Der Beklagte sei daher verpflichtet gewesen, das Therapieziel dahingehend zu ändern, dass das Sterben des Patienten durch Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen zugelassen werde. Der Kläger verlangt aus ererbtem Recht seines Vaters Schmerzensgeld sowie Ersatz für Behandlungs- und Pflegeaufwendungen.
Bisheriger Prozeßverlauf:
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht diesem ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 € zugesprochen. Der Beklagte sei im Rahmen seiner Aufklärungspflicht gehalten gewesen, mit dem Betreuer die Frage der Fortsetzung oder Beendigung der Sondenernährung eingehend zu erörtern, was er unterlassen habe. Die aus dieser Pflichtverletzung resultierende Lebens- und gleichzeitig Leidensverlängerung des Patienten stelle einen ersatzfähigen Schaden dar.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der unter anderem für das Arzthaftungsrecht zuständige VI. Zivilsenat hat auf die Revision des Beklagten das klageabweisende Urteil des Landgerichts wiederhergestellt. Dem Kläger steht kein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Dabei kann dahinstehen, ob der Beklagte Pflichten verletzt hat. Denn jedenfalls fehlt es an einem immateriellen Schaden. Hier steht der durch die künstliche Ernährung ermöglichte Zustand des Weiterlebens mit krankheitsbedingten Leiden dem Zustand gegenüber, wie er bei Abbruch der künstlichen Ernährung eingetreten wäre, also dem Tod. Das menschliche Leben ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb verbietet es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – als Schaden anzusehen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Auch wenn ein Patient selbst sein Leben als lebensunwert erachten mag mit der Folge, dass eine lebenserhaltende Maßnahme gegen seinen Willen zu unterbleiben hat, verbietet die Verfassungsordnung aller staatlichen Gewalt einschließlich der Rechtsprechung ein solches Urteil über das Leben des betroffenen Patienten mit der Schlussfolgerung, dieses Leben sei ein Schaden.
Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Ersatz der durch das Weiterleben des Patienten bedingten Behandlungs- und Pflegeaufwendungen zu. Schutzzweck etwaiger Aufklärungs- und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit lebenserhaltenden Maßnahmen ist es nicht, wirtschaftliche Belastungen, die mit dem Weiterleben und den dem Leben anhaftenden krankheitsbedingten Leiden verbunden sind, zu verhindern. Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu, den Erben das Vermögen des Patienten möglichst ungeschmälert zu erhalten.
29.01.2019
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 010/2019 vom 29.01.2019
Bundesgerichtshof entscheidet über Haftung nach unzureichender Aufklärung von Organspendern vor einer Lebendspende
Urteile vom 29. Januar 2019 – VI ZR 495/16 und VI ZR 318/17:
Verfahren VI ZR 495/16 – Sachverhalt und bisheriger Prozessverlauf:
Die Klägerin spendete ihrem an einer chronischen Niereninsuffizienz auf dem Boden einer Leichtkettenerkrankung leidenden Vater im Februar 2009 eine Niere. Im Mai 2014 kam es zum Transplantatverlust beim Vater. Die Klägerin behauptet, infolge der Organspende an einem chronischen Fatigue-Syndrom und an Niereninsuffizienz zu leiden und macht eine formal wie inhaltlich ungenügende Aufklärung geltend.
Das Landgericht hat die auf Zahlung von Schmerzensgeld und Feststellung der Ersatzpflicht für künftige Schäden gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Zwar hätten die Beklagten, ein Universitätsklinikum und dort tätige Ärzte, gegen verfahrensrechtliche Vorgaben aus § 8 Abs. 2 TPG (2007) verstoßen, weil weder eine ordnungsgemäße Niederschrift über das Aufklärungsgespräch gefertigt noch das Aufklärungsgespräch in Anwesenheit eines neutralen Arztes durchgeführt worden sei. Doch führe dieser formale Verstoß nicht automatisch zu einer Unwirksamkeit der Einwilligung der Klägerin in die Organentnahme. Eine Haftung der Beklagten folge auch nicht aus der inhaltlich unzureichenden Risikoaufklärung. Denn es greife der von den Beklagten erhobene Einwand der hypothetischen Einwilligung, da die Klägerin nicht plausibel dargelegt habe, dass sie bei ordnungsgemäßer Aufklärung von einer Organspende abgesehen hätte.
Verfahren VI ZR 318/17 – Sachverhalt und bisheriger Prozessverlauf:
Der Kläger spendete seiner an Niereninsuffizienz leidenden und dialysepflichtigen Ehefrau im August 2010 ebenfalls eine Niere. Der Kläger behauptet, seit der Organentnahme an einem chronischen Fatigue-Syndrom zu leiden. Die Risikoaufklärung sei formal wie inhaltlich unzureichend gewesen.
Das Landgericht hat die auf Ersatz materiellen und immateriellen Schadens gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg. Etwaige formale Verstöße gegen § 8 Abs. 2 TPG (2007) begründeten keine Haftung. Eine solche folge auch nicht aus der inhaltlich fehlerhaften Risikoaufklärung, da der Kläger selbst bei ordnungsgemäßer Aufklärung in die Organentnahme eingewilligt hätte.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der unter anderem für das Arzthaftungsrecht zuständige VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Vorentscheidungen auf die Revisionen der Kläger aufgehoben und die Sachen zur Feststellung des Schadensumfangs an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Zwar sind die Klagen nicht bereits wegen der festgestellten Verstöße gegen die Vorgaben des § 8 Abs. 2 Satz 3 (Anwesenheit eines neutralen Arztes beim Aufklärungsgespräch) und Satz 4 (von den Beteiligten zu unterschreibende Niederschrift über das Aufklärungsgespräch) TPG begründet. Bei den unbeachtet gebliebenen Regelungen handelt es sich (lediglich) um Form- und Verfahrensvorschriften, welche die Pflicht des Arztes zur Selbstbestimmungsaufklärung des Spenders begleiten. Verstöße hiergegen führen nicht per se zur Unwirksamkeit der Einwilligung der Spender in die Organentnahme und zu deren Rechtswidrigkeit, sondern sind (erst) im Rahmen der Beweiswürdigung als starkes Indiz dafür heranzuziehen, dass eine Aufklärung durch die – insoweit beweisbelastete – Behandlungsseite nicht oder jedenfalls nicht in hinreichender Weise stattgefunden hat.
Die Berechtigung des jeweiligen Klagebegehrens jedenfalls dem Grunde nach folgt jedoch aus den festgestellten inhaltlichen Aufklärungsmängeln. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wurden die Kläger, deren eigene Nierenfunktionswerte sich bereits präoperativ im unteren Grenzbereich befanden, nicht ordnungsgemäß über die gesundheitlichen Folgen der Organentnahme für ihre Gesundheit aufgeklärt. Die Klägerin des Verfahrens VI ZR 495/16 hätte zudem über das erhöhte Risiko eines Transplantatverlusts bei ihrem Vater aufgrund von dessen Vorerkrankung aufgeklärt werden müssen. Damit ist die von den Klägern erteilte Einwilligung in die Organentnahme unwirksam und der Eingriff jeweils rechtswidrig.
Für den von den Beklagten hiergegen erhobenen Einwand, die Kläger hätten auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in die Organentnahme eingewilligt, ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kein Raum. Der Einwand der hypothetischen Einwilligung ist im Transplantationsgesetz nicht geregelt. Angesichts des vom Gesetzgeber geschaffenen gesonderten Regelungsregimes des Transplantationsgesetzes lassen sich die zum Arzthaftungsrecht entwickelten Grundsätze der hypothetischen Einwilligung nicht auf die Lebendorganspende übertragen. Der Einwand ist auch nicht nach dem allgemeinen schadensersatzrechtlichen Gedanken des rechtmäßigen Alternativverhaltens beachtlich, weil dies dem Schutzzweck der erhöhten Aufklärungsanforderungen bei Lebendspenden (§ 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 TPG) widerspräche.
Die vom Gesetzgeber bewusst streng formulierten und in § 19 Abs. 1 Nr. 1 TPG gesondert strafbewehrten Aufklärungsvorgaben sollen den potentiellen Organspender davor schützen, sich selbst einen größeren persönlichen Schaden zuzufügen; sie dienen dem „Schutz des Spenders vor sich selbst“. Jedenfalls bei der Spende eines – wie hier einer Niere – nicht regenerierungsfähigen Organs, die nur für eine besonders nahestehende Person zulässig ist (§ 8 Abs. 1 Satz 2 TPG), befindet sich der Spender in einer besonderen Konfliktsituation, in der jede Risikoinformation für ihn relevant sein kann. Die echte Freiwilligkeit der Spende ist zudem vorab durch eine Kommission zu verifizieren (§ 8 Abs. 3 TPG). Könnte die Behandlungsseite vor diesem Hintergrund mit dem Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens eine Haftung abwenden, bliebe die rechtswidrige Organentnahme insoweit sanktionslos und würden die gesonderten Aufklärungsanforderungen des Transplantationsgesetzes unterlaufen. Dies erschütterte das notwendige Vertrauen potentieller Lebendorganspender in die Transplantationsmedizin. Denn die Einhaltung der Vorgaben des Transplantationsgesetzes ist unabdingbare Voraussetzung, wenn – um des Lebensschutzes willen – die Bereitschaft der Menschen zur Organspende langfristig gefördert werden soll.
15.01.2019:
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshof Nr. 004/2019 vom 15.01.2019
Keine Ausgleichsansprüche bei verzögerter Abfertigung wegen eines mehrstündigen Systemausfalls in einem Flughafenterminal
Urteil vom 15. Januar 2018 – X ZR 15/18 und X ZR 85/18
In beiden Fällen beanspruchen die Klägerinnen Ausgleichszahlungen in Höhe von jeweils 600 € wegen verspäteter Flüge nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c der Fluggastrechteverordnung (Verordnung (EG) Nr. 261/2004).
Sachverhalt:
Die Klägerinnen buchten bei dem beklagten Luftverkehrsunternehmen Flüge von New York nach London mit Anschlussflügen nach Stuttgart. Die Flüge von New York nach London starteten verspätet und landeten mehr als zwei Stunden nach der vorgesehenen Ankunftszeit. Infolgedessen erreichten die Reisenden den ursprünglich vorgesehenen Weiterflug in London nicht und kamen mit einer Verspätung von mehr als neun Stunden in Stuttgart an. Die Beklagte beruft sich auf außergewöhnliche Umstände.
Bisheriger Prozessverlauf:
Das Berufungsgericht hat in beiden Fällen die Klage abgewiesen. Nach seinen Feststellungen wurde die Verspätung der Flüge durch einen Ausfall aller Computersysteme an den Abfertigungsschaltern des Terminals 7 am John-F.-Kennedy-Flughafen New York verursacht. Aufgrund eines Streiks bei dem für die Telekommunikationsleitungen gegenüber dem Flughafenbetreiber verantwortlichen Unternehmen konnte der Systemausfall erst nach 13 Stunden behoben werden.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der Bundesgerichtshof hat in beiden Fällen die Revision der Klägerinnen zurückgewiesen.
Nach den Urteilen des für das Personenbeförderungsrecht zuständigen X. Zivilsenats ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass ein mehrstündiger Ausfall aller Computersysteme an den Abfertigungsschaltern eines Terminals außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 der Fluggastrechteverordnung begründen kann. Der Betrieb der technischen Einrichtungen eines Flughafens, zu denen auch die Telekommunikationsleitungen gehören, obliegt dem Flughafenbetreiber. Ein Systemausfall, der darauf beruht, dass die Funktionsfähigkeit derartiger Einrichtungen durch einen technischen Defekt über einen längeren Zeitraum beeinträchtigt oder aufgehoben wird, stellt ein Ereignis dar, das von außen auf den Flugbetrieb des Luftverkehrsunternehmens einwirkt und dessen Ablauf beeinflusst. Ein derartiges Vorkommnis ist von diesem Unternehmen jedenfalls nicht zu beherrschen, da die Überwachung, Wartung und Reparatur derartiger Einrichtungen nicht in seinen Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich fällt.
Auch die Würdigung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe mit der manuell und über Mitarbeiter in Washington telefonisch durchgeführten Abfertigung der Fluggäste alle ihr zumutbaren Maßnahmen ergriffen, um den durch den Systemausfall bedingten Beeinträchtigungen entgegenzuwirken, lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Dass die Beklagte, wie die Revisionen rügen, durch ein Ausweichen auf die technischen Einrichtungen eines anderen Terminals die Verspätung hätte verhindern können, ist weder festgestellt noch vorgetragen.
Unerheblich ist, ob die Beklagte, wie die Revisionen ferner meinen, den Start des gebuchten Flugs von London nach Stuttgart verschieben, die Klägerinnen auf einen anderen Flug von London nach Stuttgart umbuchen oder einen zusätzlichen Flug nach Stuttgart hätte durchführen können. Selbst wenn darin der Beklagten zumutbare Maßnahmen gesehen würden, kommt es hierauf nicht an, weil damit die für Art. 5 Abs. 3 der Fluggastrechteverordnung allein erhebliche Verspätung des Fluges von New York nach London nicht hätte verhindert werden können.
12.11.2018
Rechtsanwalt Dietmar Gorißen berichtet vom 185. Bielefelder Fachlehrgang Sozialrecht
Ein Schwerpunkt des 185. Bielefelder Fachlehrgangs Sozialrecht am 9.11.2018 war das für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbstständige zu beachtende Beitragsrecht in der gesetzlichen Sozialversicherung. Die gesetzlichen Regelungen und die dazu ergangene Rechtsprechung werden immer umfangreicher. Beitragspflicht und Beitragsrecht für Beschäftigte und Selbstständige, die Möglichkeiten der Befreiung von der Versicherungspflicht, aber auch die Rückkehr von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung waren Gegenstand des Vortrages der Referentin Dunja Barkow von Creytz. Verstöße gegen die geltenden Regelungen können zudem für Arbeitgeber und Selbstständige rückwirkende Haftungen auslösen, die existenzbedrohend sind. Eine informative grafische Übersicht über die nicht nur sozialrechtlichen Haftungsfolgen für Betriebsinhaber, Geschäftsführer und Vorstände präsentierte Dr. Christian Zieglmeier als Zusammenfassung seines Vortrages über sozialrechtliche Compliance-Maßnahmen im Unternehmen. Die Begleitung von Mandanten in solchen Verfahren durch unsere Kanzlei beginnt leider häufig sehr spät, nämlich wenn bereits Feststellungsbescheide über Beitragsforderungen in Höhe von zig-tausend € bekannt gegeben sind. Die Vorträge sind Anlass für den Hinweis, dass vorsorgliche und proaktive Beratung über rechtmäßiges Verhalten besonders zu Fragen der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge in Zweifelsfällen stets in Anspruch genommen werden sollte. Die Vermeidung von Beitragspflichten kann Geld sparen, der Verstoß gegen Beitragspflichten persönlich und wirtschaftlich bedrohliche Folgen haben.
21. Oktober 2017
Dr. Holger Heinen mit Vortrag bei der Mitgliederakademie der Volksbank Kleverland
Am 05. Oktober hat unser Kollege Dr. Holger Heinen in seiner Eigenschaft als Fachanwalt für Erbrecht einen Vortrag zum Thema „Wie gestalte ich ein Testament?“ gehalten. Wir freuen uns über die schöne Resonanz in der Samstagsausgabe der Rheinischen Post:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/kleve/den-erben-das-testament-erklaeren-aid-1.7156815
26.07.2018:
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshof Nr. 124/2018 vom 26.07.2018
Bundesgerichtshof schränkt Haftung des Anschlussinhabers für Urheberrechtsverletzungen über ungesichertes WLAN ein, Abmahngebühren oftmals nicht gerechtfertigt
Urteil vom 26. Juli 2018 – I ZR 64/17 – Dead Island
Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Betreiber eines Internetzugangs über WLAN und eines Tor-Exit-Nodes nach der seit dem 13. Oktober 2017 geltenden Neufassung des § 8 Abs. 1 Satz 2 des Telemediengesetzes (TMG)* zwar nicht als Störer für von Dritten über seinen Internetanschluss im Wege des Filesharings begangene Urheberrechtsverletzungen auf Unterlassung haftet. Jedoch kommt ein Sperranspruch des Rechtsinhabers gemäß § 7 Abs. 4 TMG nF in Betracht.
Sachverhalt:
Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Computerspiel „Dead Island“. Der Beklagte unterhält einen Internetanschluss. Am 6. Januar 2013 wurde das Programm „Dead Island“ über den Internetanschluss des Beklagten in einer Internet-Tauschbörse zum Herunterladen angeboten. Die Klägerin mahnte den Beklagten im März 2013 ab und forderte ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Zuvor hatte die Klägerin den Beklagten zweimal wegen im Jahr 2011 über seinen Internetanschluss begangener, auf andere Werke bezogener Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing anwaltlich abgemahnt.
Der Beklagte hat geltend gemacht, selbst keine Rechtsverletzung begangen zu haben. Er betreibe unter seiner IP-Adresse fünf öffentlich zugängliche WLAN-Hotspots und drahtgebunden zwei eingehende Kanäle aus dem Tor-Netzwerk („Tor-Exit-Nodes“).
Bisheriger Prozessverlauf:
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass dem Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln aufgegeben wird, Dritte daran zu hindern, das Computerspiel oder Teile davon der Öffentlichkeit mittels seines Internetanschlusses über eine Internettauschbörse zur Verfügung zu stellen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision des Beklagten das Urteil des Oberlandesgerichts hinsichtlich der Verurteilung zur Unterlassung aufgehoben und die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandessgericht zurückverwiesen. Die gegen die Zuerkennung der Abmahnkostenforderung gerichtete Revision hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Beklagte nach dem hierfür maßgeblichen, im Zeitpunkt der Abmahnung geltenden Recht zum Ersatz der Abmahnkosten verpflichtet ist, weil er als Störer für die Rechtsverletzung Dritter haftet. Der Beklagte hat es pflichtwidrig unterlassen, sein WLAN durch den Einsatz des im Kaufzeitpunkt aktuellen Verschlüsselungsstandards sowie eines individuellen Passworts gegen missbräuchliche Nutzung durch Dritte zu sichern. Für den Fall der privaten Bereitstellung durch den Beklagten bestand diese Pflicht ohne Weiteres bereits ab Inbetriebnahme des Anschlusses. Sofern der Beklagte den Internetzugang über WLAN gewerblich bereitgestellt hat, war er zu diesen Sicherungsmaßnahmen verpflichtet, weil er zuvor bereits darauf hingewiesen worden war, dass über seinen Internetanschluss im Jahr 2011 Urheberrechtsverletzungen im Wege des Filesharings begangen worden waren. Der Annahme einer Störerhaftung steht es nicht entgegen, dass das im Hinweis benannte Werk nicht mit dem von der erneuten Rechtsverletzung betroffenen Werk identisch ist. Die Haftungsvoraussetzungen liegen ebenfalls vor, wenn die Rechtsverletzung über den vom Beklagten betriebenen Tor-Exit-Node erfolgt ist. Der Beklagte hat es pflichtwidrig unterlassen, der ihm bekannten Gefahr von Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing mittels technischer Vorkehrungen entgegenzuwirken. Nach den revisionsrechtlich einwandfreien Feststellungen des Oberlandesgerichts ist die Sperrung von Filesharing-Software technisch möglich und dem Beklagten zumutbar.
Die Verurteilung zur Unterlassung hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, weil nach der seit dem 13. Oktober 2017 geltenden Neufassung des § 8 Abs. 1 Satz 2 TMG der Vermittler eines Internetzugangs nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz, Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden kann. Ist eine Handlung im Zeitpunkt der Revisionsentscheidung nicht mehr rechtswidrig, kommt die Zuerkennung eines Unterlassungsanspruchs nicht in Betracht.
Gegen die Anwendung des § 8 Abs. 1 Satz 2 TMG nF bestehen keine durchgreifenden unionsrechtlichen Bedenken. Zwar sind die Mitgliedstaaten gemäß Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG und Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48/EG verpflichtet, zugunsten der Rechtsinhaber die Möglichkeit gerichtlicher Anordnungen gegen Vermittler vorzusehen, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden. Der deutsche Gesetzgeber hat die Unterlassungshaftung des Zugangsvermittlers in § 8 Abs. 1 Satz 2 TMG nF zwar ausgeschlossen, jedoch zugleich in § 7 Abs. 4 TMG nF einen auf Sperrung des Zugangs zu Informationen gerichteten Anspruch gegen den Betreiber eines Internetzugangs über WLAN vorgesehen. Diese Vorschrift ist richtlinienkonform dahin fortzubilden, dass der Sperranspruch auch gegenüber den Anbietern drahtgebundener Internetzugänge geltend gemacht werden kann. Der Anspruch auf Sperrmaßnahmen ist nicht auf bestimmte Sperrmaßnahmen beschränkt und kann auch die Pflicht zur Registrierung von Nutzern, zur Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort oder – im äußersten Fall – zur vollständigen Sperrung des Zugangs umfassen.
Zur Prüfung der Frage, ob der Klägerin gegenüber dem Beklagten ein Anspruch auf Sperrung von Informationen gemäß § 7 Abs. 4 TMG nF zusteht, hat der Bundesgerichtshof die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf – Urteil vom 13. Januar 2016 – 12 O 101/15
OLG Düsseldorf – Urteil vom 16. März 2017 – I-20 U 17/16
Die maßgeblichen Vorschriften lauten:
- 8 Abs. 1 TMG nF
Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie
- die Übermittlung nicht veranlasst,
- den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und
- die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.
Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können sie insbesondere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.
7 Abs. 4 TMG nF
Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, um das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verletzen und besteht für den Inhaber dieses Rechts keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines Rechts abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem betroffenen Diensteanbieter nach § 8 Absatz 3 die Sperrung der Nutzung von Informationen verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern. Die Sperrung muss zumutbar und verhältnismäßig sein. Ein Anspruch gegen den Diensteanbieter auf Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruchs nach Satz 1 besteht außer in den Fällen des § 8 Absatz 1 Satz 3 nicht.
18. Juli 2018:
Dr. Holger Heinen zu Gast bei Wildenberg Advocaten in Nijmegen
Am 18. Juli 2018 wird unser Kollege Dr. Holger Heinen in seiner Eigenschaft als Fachanwalt für Familienrecht und Erbrecht bei unseren niederländischen Kollegen aus der Kanzlei Wildenberg Advocaten in Nijmegen als Gast an der „Scheidingsspreekuur“ also der monatlichen Scheidungssprechstunde teilnehmen und für Mandanten gemeinsam mit der niederländisches Rechtsanwältin Sigrid Ebbeng-Horstman zu Fragen des grenzüberschreitenden Rechts beratend zur Verfügung stehen.
24. März 2017
BGH zu den Voraussetzungen einer für den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen bindenden Patientenverfügung
Mitteilung der Pressestelle Bundesgerichtshof
Beschluss vom 8. Februar 2017 – XII ZB 604/15

Der unter anderem für Betreuungssachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich erneut mit den Anforderungen befasst, die eine bindende Patientenverfügung im Zusammenhang mit dem Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen erfüllen muss.
Die im Jahr 1940 geborene Betroffene erlitt im Mai 2008 einen Schlaganfall und befindet sich seit einem hypoxisch bedingten Herz-Kreislaufstillstand im Juni 2008 in einem wachkomatösen Zustand. Sie wird seitdem über eine Magensonde künstlich ernährt und mit Flüssigkeit versorgt.
Bereits im Jahr 1998 hatte die Betroffene ein mit „Patientenverfügung“ betiteltes Schriftstück unterschrieben. In diesem war niedergelegt, dass unter anderem dann, wenn keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht, oder aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibe, „lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben“ sollten.
Zu nicht genauer festgestellter Zeit zwischen 1998 und ihrem Schlaganfall hatte die Betroffene mehrfach gegenüber verschiedenen Familienangehörigen und Bekannten angesichts zweier Wachkoma-Patienten aus ihrem persönlichen Umfeld geäußert, sie wolle nicht künstlich ernährt werden, sie wolle nicht so am Leben erhalten werden, sie wolle nicht so daliegen, lieber sterbe sie. Sie habe aber durch eine Patientenverfügung vorgesorgt, das könne ihr nicht passieren.
Im Juni 2008 erhielt die Betroffene in der Zeit zwischen dem Schlaganfall und dem späteren Herz-Kreislaufstillstand einmalig die Möglichkeit, trotz Trachealkanüle zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit sagte sie ihrer Therapeutin: „Ich möchte sterben.“
Unter Vorlage der Patientenverfügung von 1998 regte der Sohn der Betroffenen im Jahr 2012 an, ihr einen Betreuer zu bestellen. Das Amtsgericht bestellte daraufhin den Sohn und den Ehemann der Betroffenen zu jeweils alleinvertretungsberechtigten Betreuern.
Der Sohn der Betroffenen ist, im Einvernehmen mit dem bis dahin behandelnden Arzt, seit 2014 der Meinung, die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr solle eingestellt werden, da dies dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen der Betroffenen entspreche. Ihr Ehemann lehnt dies ab.
Das Amtsgericht hat den Antrag der durch ihren Sohn vertretenen Betroffenen auf Genehmigung der Einstellung der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr abgelehnt. Das Landgericht hat die dagegen gerichtete Beschwerde der Betroffenen zurückgewiesen. Auf die Rechtsbeschwerden der Betroffenen und ihres Sohnes hat der Bundesgerichtshof die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Verfahren an das Landgericht zurückverwiesen.
Der vom Sohn der Betroffenen beabsichtigte Widerruf der Einwilligung in die mit Hilfe einer PEG-Magensonde ermöglichten künstlichen Ernährung nach § 1904 Abs. 2 BGB* bedarf grundsätzlich der betreuungsgerichtlichen Genehmigung, wenn – wie hier – durch den Abbruch der Maßnahme die Gefahr des Todes droht. Eine betreuungsgerichtliche Genehmigung nach § 1904 Abs. 2 BGB ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn der Betroffene einen entsprechenden eigenen Willen bereits in einer bindenden Patientenverfügung nach § 1901 a Abs. 1 BGB** niedergelegt hat und diese auf die konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. Eine schriftliche Patientenverfügung im Sinne des § 1901 a Abs. 1 BGB entfaltet aber nur dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, bei Abfassung der Patientenverfügung noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können. Dabei dürfen die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung aber auch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht.
Zur erforderlichen Bestimmtheit der Patientenverfügung hatte der Bundesgerichtshof bereits in seinem Beschluss vom 6. Juli 2016 (XII ZB 61/16) entschieden, dass zwar die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung enthält, die erforderliche Konkretisierung aber gegebenenfalls durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen kann. Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof nun weiter präzisiert und ausgesprochen, dass sich die erforderliche Konkretisierung im Einzelfall auch bei einer weniger detaillierten Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben kann. Ob in solchen Fällen eine hinreichend konkrete Patientenverfügung vorliegt, ist dann durch Auslegung der in der Patientenverfügung enthaltenen Erklärungen zu ermitteln.
Auf dieser rechtlichen Grundlage hat der Bundesgerichtshof die angefochtene Entscheidung aufgehoben, weil das Beschwerdegericht sich nicht ausreichend mit der Frage befasst hat, ob sich der von der Betroffenen errichteten Patientenverfügung eine wirksame Einwilligung in den Abbruch der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsversorgung entnehmen lässt. Denn die Betroffene hat in der Patientenverfügung ihren Willen zu der Behandlungssituation u. a. an die medizinisch eindeutige Voraussetzung geknüpft, dass bei ihr keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht. Zudem hat sie die ärztlichen Maßnahmen, die sie u.a. in diesem Fall wünscht oder ablehnt, durch die Angabe näher konkretisiert, dass Behandlung und Pflege auf Linderung von Schmerzen, Unruhe und Angst gerichtet sein sollen, selbst wenn durch die notwendige Schmerzbehandlung eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist. Diese Festlegungen in der Patientenverfügung könnten dahingehend auszulegen sein, dass die Betroffene im Falle eines aus medizinischer Sicht irreversiblen Bewusstseinsverlusts wirksam in den Abbruch der künstlichen Ernährung eingewilligt hat. Ob der derzeitige Gesundheitszustand der Betroffenen im Wachkoma auf diese konkret bezeichnete Behandlungssituation zutrifft, hat das Beschwerdegericht bislang nicht festgestellt. Dies wird es nachholen müssen.
Sollte das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis gelangen, dass der derzeitige Gesundheitszustand der Betroffenen nicht den Festlegungen der Patientenverfügung entspricht, wird es erneut zu prüfen haben, ob ein Abbruch der künstlichen Ernährung dem mutmaßlichen Willen der Betroffenen entspricht. Dieser ist anhand konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln, insbesondere anhand früherer mündlicher oder schriftlicher Äußerungen, ethischer oder religiöser Überzeugungen oder sonstiger persönlicher Wertvorstellungen der Betroffenen. Entscheidend ist dabei, wie die Betroffene selbst entschieden hätte, wenn sie noch in der Lage wäre, über sich selbst zu bestimmen.
27. Februar 2017
BGH gestattet Anordnung des Wechselmodells durch Umgangsregelung des Familiengerichts
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs Nr. 025/2017 vom 27.02.2017
Beschluss vom 1. Februar 2017 – XII ZB 601/15

Der u.a. für Familienrecht zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass und unter welchen Voraussetzungen das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils gegen den Willen des anderen Elternteils ein sog. paritätisches Wechselmodell, also die etwa hälftige Betreuung des Kindes durch beide Eltern, als Umgangsregelung anordnen darf.
Die Beteiligten zu 1 und 2 sind die geschiedenen Eltern ihres im April 2003 geborenen Sohnes. Sie sind gemeinsam sorgeberechtigt. Der Sohn hält sich bislang überwiegend bei der Mutter auf. Im Mai 2012 trafen die Eltern eine Umgangsregelung, nach welcher der Sohn den Vater alle 14 Tage am Wochenende besucht. Im vorliegenden Verfahren erstrebt der Vater die Anordnung einer Umgangsregelung in Form eines paritätischen Wechselmodells. Er will den Sohn im wöchentlichen Turnus abwechselnd von Montag nach Schulschluss bis zum folgenden Montag zum Schulbeginn zu sich nehmen. Das Amtsgericht hat den Antrag des Vaters zurückgewiesen. Dessen Beschwerde ist vor dem Oberlandesgericht ohne Erfolg geblieben.
Auf die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde des Vaters hat der BGH den Beschluss des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache an dieses zurückverwiesen. Nach § 1684 Abs. 1 BGB* hat das Kind das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil und ist jeder Elternteil zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Gemäß § 1684 Abs. 3 Satz 1 BGB kann das Familiengericht über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln.
Das Gesetz enthält keine Beschränkung des Umgangsrechts dahingehend, dass vom Gericht angeordnete Umgangskontakte nicht zu hälftigen Betreuungsanteilen der Eltern führen dürfen. Vom Gesetzeswortlaut ist vielmehr auch eine Betreuung des Kindes durch hälftige Aufteilung der Umgangszeiten auf die Eltern erfasst. Zwar orientiert sich die gesetzliche Regelung am Residenzmodell, also an Fällen mit überwiegender Betreuung durch einen Elternteil bei Ausübung eines begrenzten Umgangsrechts durch den anderen Elternteil.
Dies besagt aber nur, dass der Gesetzgeber die praktisch häufigste Gestaltung als tatsächlichen Ausgangspunkt der Regelung gewählt hat, nicht hingegen, dass er damit das Residenzmodell als gesetzliches Leitbild festlegen wollte, welches andere Betreuungsmodelle ausschließt. Dass ein Streit über den Lebensmittelpunkt des Kindes auch die elterliche Sorge und als deren Teilbereich das Aufenthaltsbestimmungsrecht betrifft, spricht jedenfalls bei Bestehen des gemeinsamen Sorgerechts der Eltern nicht gegen die Anordnung des Wechselmodells im Wege einer Umgangsregelung. Eine zum paritätischen Wechselmodell führende Umgangsregelung steht vielmehr mit dem gemeinsamen Sorgerecht im Einklang, zumal beide Eltern gleichberechtigte Inhaber der elterlichen Sorge sind und die im Wechselmodell praktizierte Betreuung sich als entsprechende Sorgerechtsausübung im gesetzlich vorgegebenen Rahmen hält.
Entscheidender Maßstab der Anordnung eines Umgangsrechts ist neben den beiderseitigen Elternrechten allerdings das Kindeswohl, das vom Gericht nach Lage des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen ist. Das Wechselmodell ist anzuordnen, wenn die geteilte Betreuung durch beide Eltern im Vergleich mit anderen Betreuungsmodellen dem Kindeswohl im konkreten Fall am besten entspricht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wechselmodell gegenüber herkömmlichen Umgangsmodellen höhere Anforderungen an die Eltern und das Kind stellt, das bei doppelter Residenz zwischen zwei Haushalten pendelt und sich auf zwei hauptsächliche Lebensumgebungen ein- bzw. umzustellen hat. Das paritätische Wechselmodell setzt zudem eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus. Dem Kindeswohl entspricht es dagegen regelmäßig nicht, ein Wechselmodell zu dem Zweck anzuordnen, diese Voraussetzungen erst herbeizuführen. Ist das Verhältnis der Eltern erheblich konfliktbelastet, so liegt die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Anordnung in der Regel nicht im wohlverstandenen Interesse des Kindes. Wesentlicher Aspekt ist zudem der vom Kind geäußerte Wille, dem mit steigendem Alter zunehmendes Gewicht beizumessen ist.
Das Familiengericht ist im Umgangsrechtsverfahren zu einer umfassenden Aufklärung verpflichtet, welche Form des Umgangs dem Kindeswohl am besten entspricht. Dies erfordert grundsätzlich auch die persönliche Anhörung des Kindes. Im vorliegenden Fall hatte das Oberlandesgericht eine persönliche Anhörung des Kindes nicht durchgeführt, weil es zu Unrecht davon ausgegangen war, dass eine auf ein Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung nach der gesetzlichen Regelung nicht möglich sei. Das Verfahren ist daher zur Nachholung der Kindesanhörung und zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen worden.
* § 1684 BGB Umgang des Kindes mit den Eltern
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet.
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten
15. Februar 2017
Dr. Scholten ist Fachanwalt für Strafrecht
Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf hat unserem Partner Dr. Karl Scholten wegen seiner besonderen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen die Befugnis verliehen, die Bezeichnung Fachanwalt für Strafrecht zu führen.
Wir freuen uns und gratulieren.